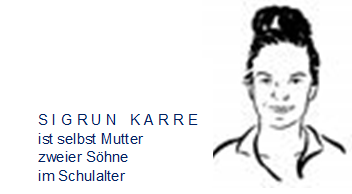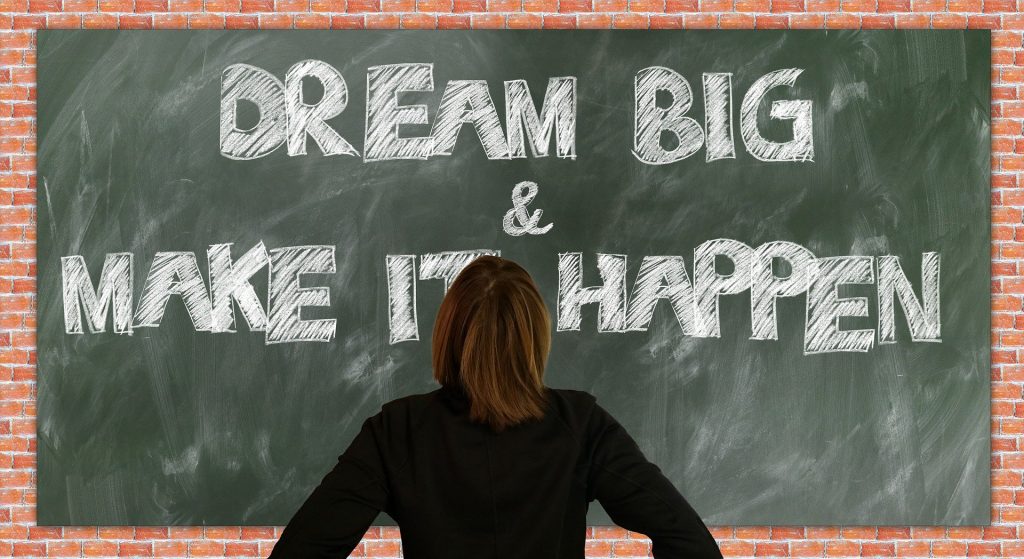Hier ein Artikel von Sigrun Karre, der ursprünglich im Megaphon #302 – Mai 2021 erschienen ist. Die dreizehnjährige Lina Touhiri schildet darin sehr offen, wie Coronakrise, Lockdown und Homeschooling sich auf ihr Leben ausgewirkt haben und wie sie darüber denkt.
Wir danken der Autorin, dem Fotografen Arno Friebes sowie der Herausgeberin des Straßenmagazins für die Erlaubnis zur Wiederveröffentlichung auf unserem Blog.
 Derzeit bin ich zweimal in der Woche in der Schule im Präsenzunterricht, die Klasse ist in zwei Gruppen geteilt. Ich habe das Glück, dass meine besten Freunde und ich in einer Gruppe sind. Meine Gruppe hat diese Woche z.B. Mittwoch und Donnerstag, nächste Woche dann Montag und Dienstag Präsenzunterricht. Für die anderen Tage bekommen wir Aufträge, die wir zu Hause erledigen und beim nächsten Unterricht in der Schule abgeben müssen. Manchmal ist das anstrengend und ein wenig kompliziert, aber es geht eigentlich. Wenn man etwas nicht versteht, schreibt man die Lehrerin oder den Lehrer über „Microsoft Teams“ an und bekommt dann meist schnell eine Antwort. Am Anfang, also letztes Jahr, als ich noch in die zweite Klasse ging, war es sehr schwer, aber man gewöhnt sich langsam daran, eigenständig zu arbeiten, und wir haben schon vor dem Lockdown mit dem Programm gearbeitet, da hatten wir an unserer Schule sicher einen Vorteil. Ich habe dann auch von der Schule einen Laptop bekommen, weil mein Bruder in der 1. Klasse auch einen Laptop für das Homeschooling gebraucht hat und wir nur einen hatten.
Derzeit bin ich zweimal in der Woche in der Schule im Präsenzunterricht, die Klasse ist in zwei Gruppen geteilt. Ich habe das Glück, dass meine besten Freunde und ich in einer Gruppe sind. Meine Gruppe hat diese Woche z.B. Mittwoch und Donnerstag, nächste Woche dann Montag und Dienstag Präsenzunterricht. Für die anderen Tage bekommen wir Aufträge, die wir zu Hause erledigen und beim nächsten Unterricht in der Schule abgeben müssen. Manchmal ist das anstrengend und ein wenig kompliziert, aber es geht eigentlich. Wenn man etwas nicht versteht, schreibt man die Lehrerin oder den Lehrer über „Microsoft Teams“ an und bekommt dann meist schnell eine Antwort. Am Anfang, also letztes Jahr, als ich noch in die zweite Klasse ging, war es sehr schwer, aber man gewöhnt sich langsam daran, eigenständig zu arbeiten, und wir haben schon vor dem Lockdown mit dem Programm gearbeitet, da hatten wir an unserer Schule sicher einen Vorteil. Ich habe dann auch von der Schule einen Laptop bekommen, weil mein Bruder in der 1. Klasse auch einen Laptop für das Homeschooling gebraucht hat und wir nur einen hatten.
Früher war ich sehr motiviert, etwas für die Schule zu arbeiten, aber langsam sinkt die Motivation, weil man hat im Lockdown voll viel Stress gehabt in der Schule, die Lehrer haben viel Aufgabe gegeben und man wusste zwischendurch nicht, wo man welche Aufgabe hat. Das war schon ein bisschen stressig. Wenn man etwas Neues lernt, dann finde ich es über den Bildschirm schwieriger, es zu verstehen. Daher ist es gut, dass wir jetzt wieder zweimal in der Woche Unterricht in der Schule haben. Besonders bei Mathematik ist es für mich im Präsenzunterricht leichter. Ein- oder zweimal im Online-Unterricht hat die Lehrerin gesagt, wir sollen unsere Kameras einschalten, da musste ich schnell meine Haare kämen und einen Pulli überziehen. Man saß mehr Zeit alleine am Schreibtisch als früher. Aber man muss eben trotzdem die Zeit finden, rauszugehen am Nachmittag an die frische Luft. Ich versuche da, bewusst eine Routine einzuhalten und dazwischen Pausen zu machen und z.B. nicht zu lange zu schlafen, damit ich den Rhythmus beibehalte.

Ich wohne mit meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder in einer Siedlung, da haben wir schon sehr viele Spielmöglichkeiten im Freien und das nütze ich. Ich vermisse es, normalen Unterricht zu haben, sechs Stunden lang die Maske zu tragen, wird mit der Zeit schon anstrengend, oder eben auch mit Maske Schularbeit zu schreiben oder zwischen den Stunden in den dritten Stock zu gehen. Man gewöhnt sich ein bisschen daran, aber es ist schon anstrengend. Es ist schade, dass man sonst seine Freunde nicht treffen kann. Für mich ist es aber kein Problem, im Lockdown viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, wir machen immer was Lustiges, z. B. backen oder spazieren gehen. Ich finde es eigentlich sogar schön, Zeit für die Familie zu haben.
Andere finden das nicht so toll. Manche haben auch Panik und desinfizieren ständig ihre Hände und tragen im Freien eine Maske. Ich verstehe natürlich, dass sie Angst haben, weil besonders ältere Menschen sterben und das schlimm ist. Aber ich finde, man soll auch das Leben leben, natürlich die Maßnahmen befolgen, aber auch irgendwie normal bleiben. Man soll schon auch frische Luft einatmen und genießen und nicht immer nur Maske tragen, das ist nicht so gesund. Ich glaube, wenn es jemandem wegen dem Lockdown nicht so gut geht, dann sollte er versuchen, zu entspannen. Für manche ist es z.B. entspannend, Musik zu hören. Dann beruhigt man sich. Mir hilft auch Rausgehen an die frische Luft, wenn ich traurig bin wegen einer Sache. Wenn man jeden Tag die neuesten Informationen zu Corona liest und jeden Tag liest soundsoviele Fälle oder Tote, dann geht es der Person nicht so gut. Ich versuche, das nicht zu machen, ich kenne Leute, die jeden Tag auf Facebook oder Instagram die neuesten Zahlen anschauen, ich finde das nicht so gut. Vielleicht werden die Leute davon ein bisschen aggressiv, ist mein Eindruck, weil sie haben dann das Gefühl, die Zahlen steigen und sie können nichts machen. Und sie sagen „Oh, mein Gott“ und bekommen negative Gedanken. Ich denke mir, ich bin ein Kind und sollte einfach auch meine Zeit leben. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt wieder erlaubt ist, Shopping ist auf jeden Fall erlaubt, aber das mach ich jetzt nicht. Mein Taekwondo-Training findet derzeit online statt, das ist OK, aber es ist jetzt nicht so ganz meines. Man kann da auch nicht so viel springen wie beim normalen Training – wegen der Nachbarn, die unter uns wohnen.
Ich möchte später gerne Volksschullehrerin werden, weil ich kleine Kinder sehr gerne mag und voll niedlich finde und gerne mit ihnen rede oder spiele. Ich habe sehr viele Cousinen und Cousins in Tunesien, die noch klein sind, gefühlt kommen jedes Jahr zwei Neue dazu. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern stammen aus Tunesien. Wenn ich mit meiner Oma oder Tante telefoniere, dann sagen die man merkt in Tunesien gar nicht, dass Corona existiert, wenn man rausgeht. Sie gehen ganz normal raus und arbeiten auch ganz normal, nicht so wie in Österreich. Aber man bekommt von Corona in den Medien mit. Ich telefoniere mit meiner Großfamilie in Tunesien jeden Tag über Messenger und hoffe sehr, dass ich sie diesen Sommer wieder besuchen kann, ich hab sie vor drei Jahren zuletzt gesehen. Ich habe zu meinen 13. Geburtstag im November keine Party mit meinen Freunden gefeiert, wahrscheinlich wird das dieses Jahr auch nicht möglich sein, das geht eben gerade nicht. Ich wünsche mir, dass wir gesund bleiben und dass die Leute versuchen, sich an die Regeln halten, damit die Zahlen nicht steigen, damit wir bald wieder normal leben und uns normal treffen können.
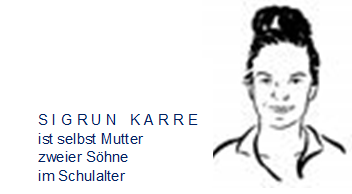
Weiterlesen | Hinterlasse einen Kommentar



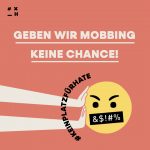



 Schulsozialarbeit versuchte, die Schulen dabei zu unterstützen, mit Eltern und Schüler*innen telefonisch Kontakt aufzunehmen und sie an ihre schulischen Pflichten zu erinnern. Die Zusammenarbeit mit Lehrer*innen und Schulleiter*innen wurde hier als sehr wichtig empfunden. Schulsozialarbeit erlebte die Lehrer*innen zudem als sehr motiviert in der Kontaktaufnahme und in der Bereitschaft, den Schüler*innen bestmöglich Hilfestellung zu geben. Viele nahmen zu den Kindern persönlich Kontakt auf, versuchten sie zu motivieren und so die Verbindung zu halten. Wenn der Kontakt abbrach, wurde Schulsozialarbeit sogleich eingebunden und es wurde gemeinsam versucht, Kind und Eltern zu erreichen. Über Freunde und Freundinnen wurde der Kontakt mit schwer erreichbaren Schüler*innen über Instagram aufgenommen bzw. wiederaufgebaut. Teils konnten Schüler*innen so dazu ermuntert werden, sich bei den Lehrer*innen zumindest zu melden, was wiederum eine Anzeige verhinderte.
Schulsozialarbeit versuchte, die Schulen dabei zu unterstützen, mit Eltern und Schüler*innen telefonisch Kontakt aufzunehmen und sie an ihre schulischen Pflichten zu erinnern. Die Zusammenarbeit mit Lehrer*innen und Schulleiter*innen wurde hier als sehr wichtig empfunden. Schulsozialarbeit erlebte die Lehrer*innen zudem als sehr motiviert in der Kontaktaufnahme und in der Bereitschaft, den Schüler*innen bestmöglich Hilfestellung zu geben. Viele nahmen zu den Kindern persönlich Kontakt auf, versuchten sie zu motivieren und so die Verbindung zu halten. Wenn der Kontakt abbrach, wurde Schulsozialarbeit sogleich eingebunden und es wurde gemeinsam versucht, Kind und Eltern zu erreichen. Über Freunde und Freundinnen wurde der Kontakt mit schwer erreichbaren Schüler*innen über Instagram aufgenommen bzw. wiederaufgebaut. Teils konnten Schüler*innen so dazu ermuntert werden, sich bei den Lehrer*innen zumindest zu melden, was wiederum eine Anzeige verhinderte.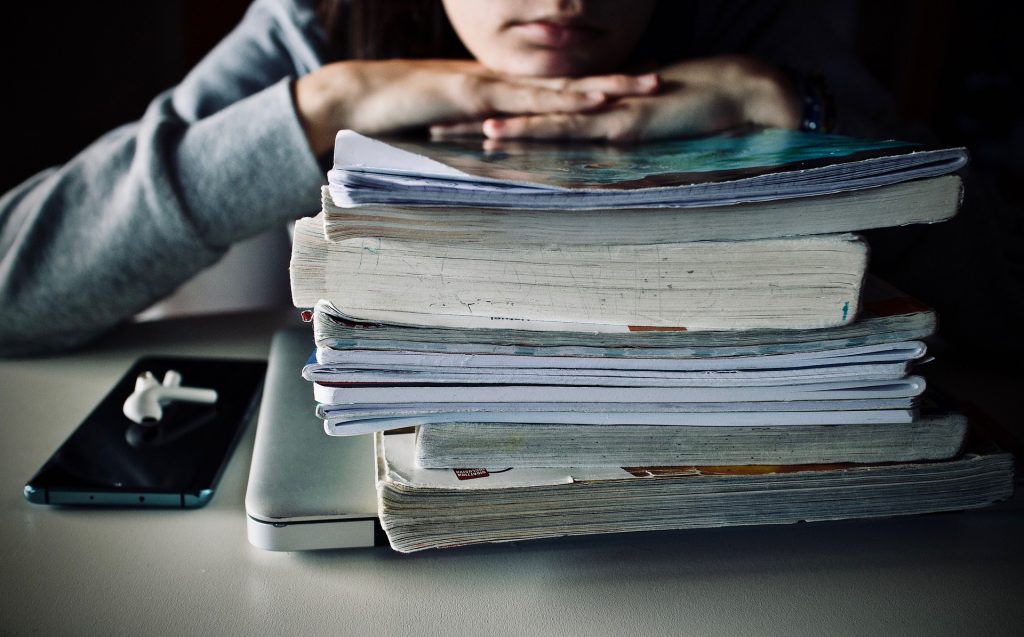 Durch die veränderte Lebenssituation der Kinder ergaben sich auch sonst viele Probleme. Es kam vermehrt zu innerfamiliären Spannungen. Eltern fürchteten sich davor, ihre Kinder aus dem Haus zu lassen, wobei Medienberichte und die vermehrte Polizeipräsenz in der Stadt diese Ängste noch weiter verstärkten. Immer öfter wurde in den Beratungen zum Thema, dass es die Kinder zu Hause nicht mehr aushielten, dass die Eltern sie nicht hinaus ließen, dass sie mit dem selbstständigen Lernen daheim überfordert wären oder dass sie große Ängste plagten, sie könnten ihre eigenen Eltern mit Covid19 anstecken oder ihre Großeltern hier bzw. in den Ländern, in denen diese lebten, könnten krank werden und Schlimmeres. Auch infizierten sich einige Kinder selbst mit Covid19 bzw. gab es Fälle, wo ein Familienmitglied an Covid19 erkrankte und in weiterer Folge sogar daran verstarb. Soziale Kontakte wie Freund*innen und/oder Familienangehörige aus dem weiteren familiären Umfeld, die ihnen in dieser Situation Halt hätten geben können, fehlten. Perspektivenlosigkeit, familiäre Krisen und depressive Verstimmungen kamen vermehrt auf. Die Lage spitzte sich in manchen Fällen derartig zu, dass Kinder von Zuhause wegliefen und Schulsozialarbeit teilweise das Wochenende damit verbrachte, mit Eltern/Kindern und Jugendamt bzw. Notunterbringungen zu telefonieren.
Durch die veränderte Lebenssituation der Kinder ergaben sich auch sonst viele Probleme. Es kam vermehrt zu innerfamiliären Spannungen. Eltern fürchteten sich davor, ihre Kinder aus dem Haus zu lassen, wobei Medienberichte und die vermehrte Polizeipräsenz in der Stadt diese Ängste noch weiter verstärkten. Immer öfter wurde in den Beratungen zum Thema, dass es die Kinder zu Hause nicht mehr aushielten, dass die Eltern sie nicht hinaus ließen, dass sie mit dem selbstständigen Lernen daheim überfordert wären oder dass sie große Ängste plagten, sie könnten ihre eigenen Eltern mit Covid19 anstecken oder ihre Großeltern hier bzw. in den Ländern, in denen diese lebten, könnten krank werden und Schlimmeres. Auch infizierten sich einige Kinder selbst mit Covid19 bzw. gab es Fälle, wo ein Familienmitglied an Covid19 erkrankte und in weiterer Folge sogar daran verstarb. Soziale Kontakte wie Freund*innen und/oder Familienangehörige aus dem weiteren familiären Umfeld, die ihnen in dieser Situation Halt hätten geben können, fehlten. Perspektivenlosigkeit, familiäre Krisen und depressive Verstimmungen kamen vermehrt auf. Die Lage spitzte sich in manchen Fällen derartig zu, dass Kinder von Zuhause wegliefen und Schulsozialarbeit teilweise das Wochenende damit verbrachte, mit Eltern/Kindern und Jugendamt bzw. Notunterbringungen zu telefonieren.

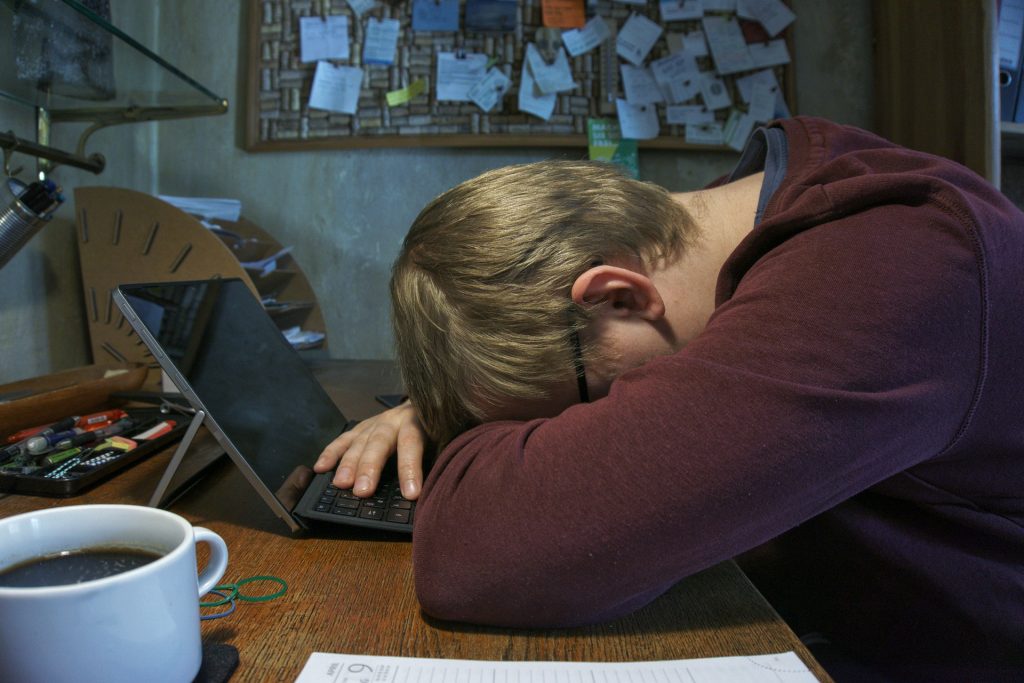

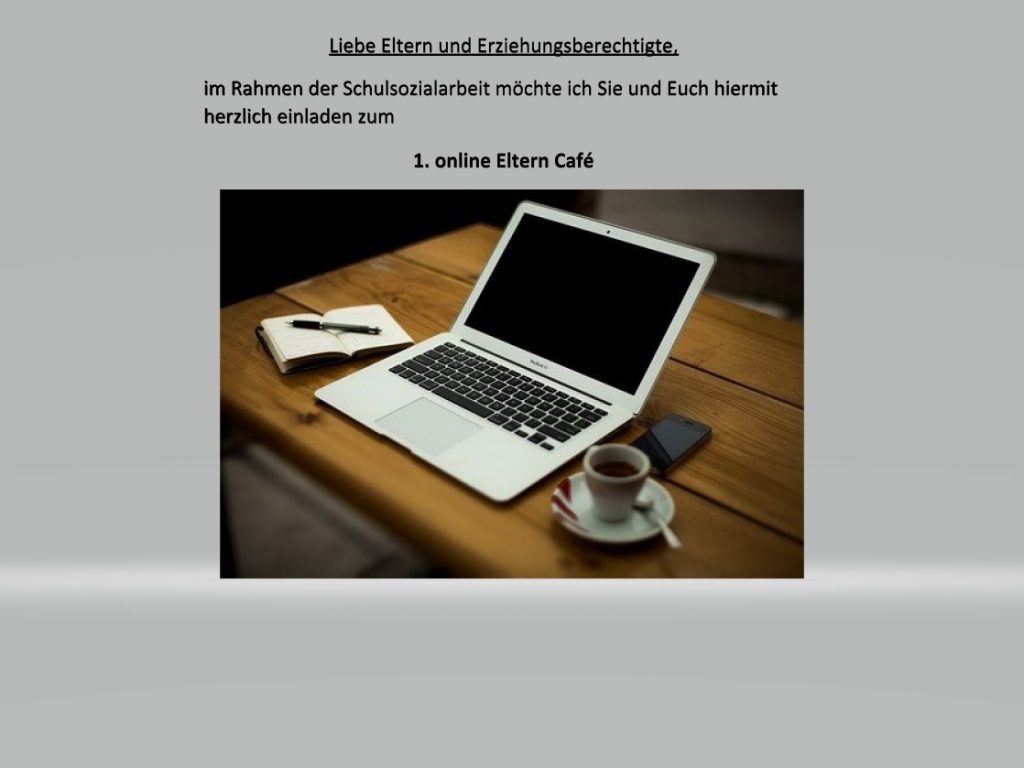
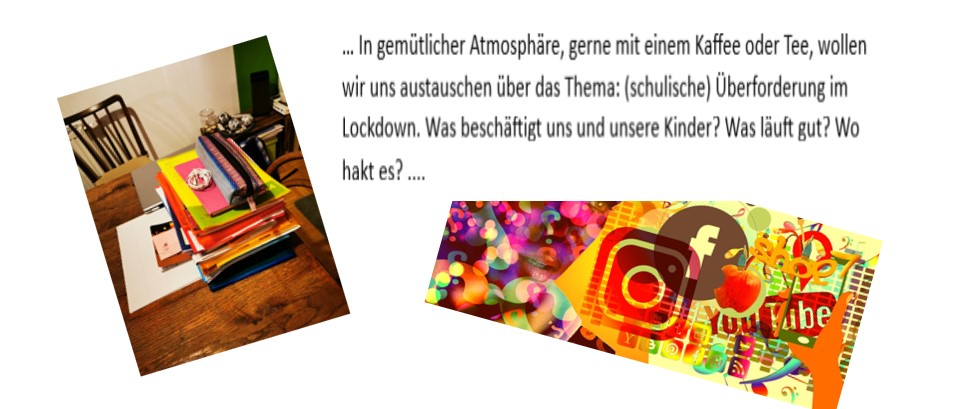

 Derzeit bin ich zweimal in der Woche in der Schule im Präsenzunterricht, die Klasse ist in zwei Gruppen geteilt. Ich habe das Glück, dass meine besten Freunde und ich in einer Gruppe sind. Meine Gruppe hat diese Woche z.B. Mittwoch und Donnerstag, nächste Woche dann Montag und Dienstag Präsenzunterricht. Für die anderen Tage bekommen wir Aufträge, die wir zu Hause erledigen und beim nächsten Unterricht in der Schule abgeben müssen. Manchmal ist das anstrengend und ein wenig kompliziert, aber es geht eigentlich. Wenn man etwas nicht versteht, schreibt man die Lehrerin oder den Lehrer über „Microsoft Teams“ an und bekommt dann meist schnell eine Antwort. Am Anfang, also letztes Jahr, als ich noch in die zweite Klasse ging, war es sehr schwer, aber man gewöhnt sich langsam daran, eigenständig zu arbeiten, und wir haben schon vor dem Lockdown mit dem Programm gearbeitet, da hatten wir an unserer Schule sicher einen Vorteil. Ich habe dann auch von der Schule einen Laptop bekommen, weil mein Bruder in der 1. Klasse auch einen Laptop für das Homeschooling gebraucht hat und wir nur einen hatten.
Derzeit bin ich zweimal in der Woche in der Schule im Präsenzunterricht, die Klasse ist in zwei Gruppen geteilt. Ich habe das Glück, dass meine besten Freunde und ich in einer Gruppe sind. Meine Gruppe hat diese Woche z.B. Mittwoch und Donnerstag, nächste Woche dann Montag und Dienstag Präsenzunterricht. Für die anderen Tage bekommen wir Aufträge, die wir zu Hause erledigen und beim nächsten Unterricht in der Schule abgeben müssen. Manchmal ist das anstrengend und ein wenig kompliziert, aber es geht eigentlich. Wenn man etwas nicht versteht, schreibt man die Lehrerin oder den Lehrer über „Microsoft Teams“ an und bekommt dann meist schnell eine Antwort. Am Anfang, also letztes Jahr, als ich noch in die zweite Klasse ging, war es sehr schwer, aber man gewöhnt sich langsam daran, eigenständig zu arbeiten, und wir haben schon vor dem Lockdown mit dem Programm gearbeitet, da hatten wir an unserer Schule sicher einen Vorteil. Ich habe dann auch von der Schule einen Laptop bekommen, weil mein Bruder in der 1. Klasse auch einen Laptop für das Homeschooling gebraucht hat und wir nur einen hatten.